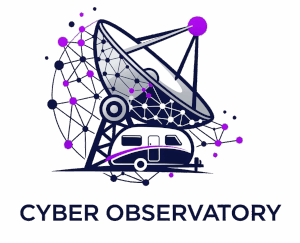Bauanleitungen und Materialien
Der Bau eines eigenen Radioteleskops kann ein faszinierendes Projekt sein, das Einblicke in die Funkastronomie ermöglicht. Es gibt verschiedene Ansätze, je nachdem, welche Materialien zur Verfügung stehen und welches Budget eingeplant ist. Grundsätzlich besteht ein Radioteleskop aus einer Antenne, die Radiowellen einfängt, einem Empfänger, der die Signale verarbeitet, und einer Möglichkeit, die Daten darzustellen.
- 1. Upcycling: Radioteleskop aus gebrauchten Gegenständen
- 2. Radioteleskop aus Baumarkt-üblichen Teilen
- 3. Das günstigst mögliche Radioteleskop
- 4. Mögliche Messergebnisse und Erkundungen
- 5. Einschränkungen und was nicht möglich ist (Vergleich mit Effelsberg)
- 6. Quellen
1. Upcycling: Radioteleskop aus gebrauchten Gegenständen
Upcycling ist eine kostengünstige und nachhaltige Methode, um ein Radioteleskop zu bauen. Oft können bereits vorhandene oder günstig erwerbbare Komponenten genutzt werden.
Materialien und Aufbau:
- SAT-Schüsseln: Eine handelsübliche Satellitenschüssel dient hervorragend als Parabolantenne, um Radiowellen zu bündeln. Sie leitet die Signale zum LNB (Low Noise Block Converter).
- LNB (Low Noise Block Converter): Dieses Bauteil, das normalerweise an einer Satellitenschüssel montiert ist, empfängt die gebündelten Signale und wandelt sie in eine niedrigere Frequenz um, die leichter zu verarbeiten ist.
- DVB-T Sticks (RTL-SDR): Viele moderne DVB-T Empfänger, die auf dem RTL2832U-Chip basieren, können als Software Defined Radios (SDR) verwendet werden. Diese Sticks sind günstig und können ein breites Frequenzspektrum empfangen. Sie werden an einen Computer angeschlossen, wo die eigentliche Signalverarbeitung stattfindet.
- Konservendosen / Haushaltsmaterialien: Für einfachere Hornantennen oder zur Abschirmung können Konservendosen oder Materialien wie Schaumstoffplatten und Alufolie verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist eine Hornantenne aus Styropor oder Hartschaumplatte, die mit Aluminiumfolie ausgekleidet ist. Ein solcher Aufbau erfordert zusätzlich einen rauscharme Verstärker (LNA) und einen SDR-Dongle.
- Weitere Komponenten: Koaxialkabel (zum Verbinden von LNB/Antenne mit dem Empfänger), eine Stromversorgung für das LNB (12-18V DC, oft über den Receiver bereitgestellt oder ein externes Netzteil), und eine stabile Halterung (Stativ oder feste Montage) zur Ausrichtung der Antenne.
Budget (Upcycling):
Das Budget für ein Upcycling-Radioteleskop kann sehr niedrig sein:
- Eine gebrauchte SAT-Schüssel und ein gebrauchtes LNB sind oft für wenige Euro (ca. 3-5 € pro Stück) oder sogar kostenlos erhältlich.
- Ein einfacher DVB-T (RTL-SDR) Stick kostet ca. 20-30 €.
- Koaxialkabel, Stecker und Kleinteile schlagen mit weiteren 5-10 € zu Buche.
- Gesamt: Ein sehr einfaches Setup kann so für unter 50 € realisiert werden, im besten Fall sogar für unter 20 € wenn viele Teile bereits vorhanden sind.
- Ein spezieller SDR-Receiver für Radioastronomie, wie der SDRplay RSP1B für das Radio Jove Projekt, kostet um die 150-250 US-Dollar. Ein komplettes Radio Jove Antennen-Kit liegt bei etwa 133 US-Dollar (ohne Stützstruktur).
- Ein RTL-SDR-basiertes 21cm Wasserstofflinien-Teleskop mit WiFi-Parabolgitter-Antenne, LNA und Adaptern kann etwa 180 US-Dollar kosten (ohne PC).
2. Radioteleskop aus Baumarkt-üblichen Teilen
Einige Komponenten eines DIY-Radioteleskops können auch aus dem Baumarkt stammen, insbesondere für die Antennenstruktur oder die Montage.
Materialien und Aufbau:
- Strukturmaterial: Für die Trägerstruktur oder eine selbstgebaute Antenne (z.B. Hornantenne) können Holzlatten, PVC-Rohre oder Aluminiumprofile aus dem Baumarkt verwendet werden.
- Reflektoren: Aluminiumfolie oder dünne Aluminiumbleche sind ideal als Reflektorflächen für parabolische oder Hornantennen.
- Befestigungsmaterial: Schrauben, Muttern, Kabelbinder und Schellen sind standardmäßig im Baumarkt erhältlich.
- Kabel und Anschlüsse: Koaxialkabel, elektrische Leitungen und passende Stecker (z.B. F-Stecker, BNC-Stecker) sind ebenfalls dort zu finden.
Das Bauprinzip ähnelt dem Upcycling, wobei hier die Möglichkeit besteht, die Antennenform (z.B. eine präzisere Hornantenne) von Grund auf selbst zu konstruieren, anstatt eine fertige Satellitenschüssel zu verwenden. Dies kann jedoch komplexer sein und erfordert genaue Berechnungen.
3. Das günstigst mögliche Radioteleskop
Das absolut günstigste Radioteleskop kann oft aus einer Kombination von Upcycling-Materialien und sehr einfachen, leicht erhältlichen Komponenten gebaut werden.
Materialien und Aufbau:
- Antenne: Eine alte Satellitenschüssel mit LNB ist die Basis.
- Empfänger: Ein gebrauchter Satelliten-Signalstärkemesser (oft ab 10-20 € online erhältlich) ist der einfachste Empfänger. Alternativ, falls vorhanden, ein alter DVB-T (RTL-SDR) Stick.
- Anzeige: Bei einem Signalstärkemesser direkt am Gerät (Zeigerausschlag/LEDs). Bei einem SDR-Stick ein Laptop oder PC mit geeigneter Software (z.B. SDR# oder Gnu Radio).
- Energieversorgung: Batterien oder ein altes Netzteil für das LNB.
- Kabel: Kurzes Stück Koaxialkabel mit F-Steckern.
Budget (Günstigst möglich):
Mit viel Glück und dem Einsatz von bereits vorhandenen oder geschenkten Teilen ist ein Grund-Setup für unter 20 € realisierbar.
4. Mögliche Messergebnisse und Erkundungen
Mit einem DIY-Radioteleskop lassen sich faszinierende Phänomene des Kosmos untersuchen:
- Kosmisches Rauschen: Das Grundrauschen aus dem Weltall ist immer vorhanden und kann detektiert werden.
- Die Sonne: Die Sonne ist eine sehr starke Radioquelle. Man kann ihre normalen Emissionen und sogar Ausbrüche wie Flares oder koronalen Massenauswürfe als Anstieg im Radiosignal registrieren. Dies erfordert jedoch Vorsicht, um den Empfänger nicht zu übersteuern.
- Der Mond: Der Mond ist eine thermische Radioquelle. Seine Wärmestrahlung kann je nach Frequenz und Empfindlichkeit des Teleskops detektiert werden.
- Jupiter: Jupiter ist eine sehr interessante Radioquelle. Durch die Wechselwirkung seines starken Magnetfeldes mit seinem Mond Io erzeugt er intensive Radiostrahlung im Dezimeter- und Dekameterbereich. Das „Radio Jove“ Projekt ist speziell darauf ausgelegt, Jupiters Radiostrahlung zu empfangen. Die Beobachtung ist am besten nachts möglich, wenn die Erde die Sonne abschirmt.
- Wasserstoffmoleküle (21cm-Linie): Dies ist ein fortgeschrittenes, aber erreichbares Ziel für Amateure. Die 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserstoffs (HI) ist ein wichtiges Signal aus unserer Milchstraße. Die Detektion erfordert einen empfindlichen LNA (Low Noise Amplifier) für diese Frequenz und die Verwendung eines SDR-Sticks mit spezieller Software (z.B. SDR# mit dem IF Average Plugin oder GNU Radio), um die schwachen Signale aus dem Rauschen herauszufiltern. Man kann damit die Rotation unserer Galaxie und die Verteilung von Wasserstoffgas kartieren (Drift-Scan-Methode).
- Supernova-Überreste: Objekte wie Cassiopeia A, ein heller Supernova-Überrest, können unter guten Bedingungen mit größeren DIY-Antennen detektiert werden.
- Meteore: Durch die Reflexion von Radiowellen an den ionisierten Spuren von Meteoren in der Atmosphäre können Meteorschauer indirekt beobachtet werden. Dies erfordert spezifische Frequenzen und Software wie RadioSkyPipe.
- Pulsare: Die Detektion von Pulsaren ist für Amateure extrem anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Es erfordert sehr große Antennen (3-6m Durchmesser), extrem rauscharme Verstärker, hohe Bandbreiten und anspruchsvolle Software zur Datenanalyse (z.B. Faltung der Signale über lange Zeiträume, De-Dispersion). Man kann typischerweise nur ein „Ansteigen des Rauschens“ durch die integrierten Impulse über längere Zeiträume detektieren, nicht jedoch die einzelnen, extrem schwachen Pulse in Echtzeit „hören“.
5. Einschränkungen und was nicht möglich ist (Vergleich mit Effelsberg)
Während DIY-Radioteleskope spannende Einblicke bieten, gibt es klare Grenzen im Vergleich zu professionellen Sternwarten wie dem Radioteleskop Effelsberg:
- Atmosphärenzusammensetzung: Die Analyse der Atmosphärenzusammensetzung von Planeten oder anderen Himmelskörpern ist mit DIY-Radioteleskopen nicht möglich. Dies erfordert extrem hohe spektrale Auflösung, sehr empfindliche Detektoren und oft Beobachtungen in spezifischen Frequenzbändern (z.B. Millimeterwellen), die von Amateurausrüstung nicht erreicht werden können. Große Observatorien wie Effelsberg sind zudem oft an sehr trockenen Standorten angesiedelt, um Interferenzen durch Wasserdampf in der Erdatmosphäre zu minimieren.
- Geringe Signalstärke und Detailgrad: DIY-Teleskope haben eine wesentlich geringere Empfindlichkeit und Winkelauflösung als professionelle Instrumente. Das bedeutet, dass sehr schwache Radioquellen nicht detektiert und feine Strukturen nicht aufgelöst werden können.
- Größe und Komplexität: Das Radioteleskop Effelsberg des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie ist mit 100 Metern Durchmesser eine der größten vollbeweglichen Radioteleskope der Welt. Es wiegt 3200 Tonnen und ist in der Lage, das gesamte Spektrum von 300 MHz bis 90 GHz zu beobachten. Seine spezialisierten Instrumente ermöglichen unter anderem hochauflösende Kartierung von Galaxien, detaillierte Pulsarbeobachtungen und die Untersuchung von Moleküllinien in Gas- und Staubwolken. Solche technischen Spezifikationen und die damit verbundenen Forschungsmöglichkeiten sind mit Amateurmitteln nicht annähernd zu erreichen.
- Interferenzen: Amateurstandorte sind oft stärker von terrestrischen Funkstörungen (Mobilfunk, WLAN, Rundfunk) betroffen, was die Beobachtung schwacher astronomischer Signale erschwert.
Trotz dieser Einschränkungen bieten DIY-Radioteleskope eine hervorragende Möglichkeit, die Grundlagen der Funkastronomie zu erlernen und eigene Entdeckungen zu machen.
6. Quellen
- Building a 21cm Hydrogen Line Radio Telescope with a $180 Budget
- Radio Jove
- Radio Astronomy by Hamilton RASC
- Build a Radio Telescope from a TV Satellite Dish
- Das Radioteleskop Effelsberg
- Essential Radio Astronomy – Chapter 1: Basic Radio Astronomy
- How to Make a Radio Telescope From Household Materials
- Pulsar Detection for Amateurs by I1NDP
- Pulsars in Amateur Radio Astronomy (AAVSO)
- Small Aperture Pulsar Detection (Peter East)
Source: https://g.co/gemini/share/f6bb7b69fa27
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 6:47 — 3.1MB)